


Aus dem Fehdewesen
FA12-2020
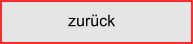
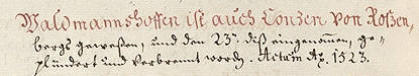
Kuntz von Rosenberg - Plackerey und Fehden
Zum Ewigen Landfrieden
Wenden wir uns zuerst dem kaiserlich angeordneten Landfrieden zu.
Der "Ewige Landfrieden" von 1495 war der Versuch, eine Wahrung von Rechten durch Gewalt zu beschränken. Der Ewige
Landfrieden wurde vom Kaiser zur Wahrung des Friedens angeordnet und von fürstlich-adeligen Teilnehmern mehr oder
minder freiwillig beschworen. Damit ist festgelegt, dass die Fürsten auf eine eigene Fehdetätigkeit verzichten werden und
Fehdetätigkeiten an gewisse Regeln gebunden werden. Es sollen Untergebene geschützt werden oder, falls sie selbst
fehdeberechtigt sind, dazu angehalten werden.
Gründe sind in dem "Kriegs"-zustand zu finden, der schon damit ausgelöst werden kann, dass in ungeklärte Streitfällen
Gewalt ausgeübt wird oder das Gewaltrecht ausgelegt wird, um Raub und Besitzaneignung zu rechtfertigen. Es soll von
Fürsten, Adeligen und Städten gleichermaßen angewandt werden.
Der Landfrieden will keine Fehdeaufhebung erzielen sondern die "Spielregeln" festlegen, unter denen einzelne Adelige ihr
Recht durchsetzen können. Wer gegen diese Spielregeln verstößt wird in die Acht genommen.
Schon vorher wurden Landfrieden angeordnet.
1404 ist in den Akten des Hochstift Würzburg nachzulesen: "dies sind die ritter und [edel-] knechte, die dem bischof von
würzburg, [johannes von egloffstein], den landfrieden geschworen haben: " .. Fritz Truchseß von Baldersheim.. , die doerfer
.. waldmannshofen.."

Leonhard von Rosenberg
Nicht nur Kunz von Rosenberg war in Fehden involviert, gehen wir zurück an den Anfang des 16. Jahrhunderts.
Leonhard von Rosenberg, der von 1502 - 1512 brandenburgische Amtmann von Uffenheim ist, hat die Güter in
Waldmannshofen von seinem Bruder Hieronymus geerbt und wurde 1507 vom Markgrafen belehnt.

Die Geislingen-Fehde
Hans von Geislingen, dessen Bruder 1506 von Reisigen (Reitern) der Stadt Nürnberg, die einen Ochsenzug eskortierten,
getötet wurde, führt im Oktober 1510 mit mehreren Rittern, darunter Leonhard von Rosenberg, eine gewaltsame Aktion
durch, nachdem die von Geislingen eingeklagte Schadenersatzforderung verhandelt und das Verfahren eingestellt wurde.
Daraufhin wurden sie vom Kaiser im Dezember 1510 in die Acht erklärt, "weil sie Nürnberg muthwillige fehde
zugeschrieben und schon vor Überschickung des feindsbriefes Hansen Vischer, Georg Volkamer und andere gefangen
genommen und weggeführt hatten".
Im Oktober 1511 passiert eine Nürnberger Reisegruppe das Aktionsgebiet einer bischöflich-bambergischen
Jagdgesellschaft. Der Bischof entsendet seinen Diener Hans Thomas von Absberg mit Knechten zu den unbekannten
Reisenden, um die Personalien aufzunehmen. Hier erfährt Absberg auch das Ziel der Reise. Am nächsten Morgen
überfällt Absberg mit seinen Knechten die Reisenden. Absberg beauftragt zwei Knechte, die zur Einholung des
Lösegeldes weggeschickt wurden, Hans von Geislingen als Nutznießer dieser Aktion zu benennen.
Die beiden Nürnberger Patrizier kamen nun in den Genuss eines mehrtägigen Schlossbesuchs zu Vorderfrankenberg und
Waldmannshofen. Die ursprünglich geplante Lösegeldübergabe war 4 Wochen später, tatsächlich sollen sie sich 37
Wochen auf der rosenbergischen Burg aufgehalten haben.
Im November 1511 ist ein Schlichtungstermin in der geislingischen Angelegenheit angesetzt. Unter Vorsitz von Markgraf
Friedrich von Ansbach wird kein Ergebnis erzielt. Seine Adelsnähe beweist der Markgraf mit enormen Zugeständnissen,
auf die die Nürnberger letztendlich nicht eingehen. Dieses Ergebnis spitzt das Fehdegeschehen 1511 und 1512 zwischen
einigen Rittern und der Stadt Nürnberg immer mehr zu.
Als Konsequenz wird eine erneute Reichsacht gegen Geislingen und seine Helferschaft verhängt. Die Antwort ist eine
Überfallserie bis Ende 1512. In dem Umfeld der fehdeführenden Ritter ist neben Leonhard von Rosenberg auch Eberhard
Geyer von Giebelstadt, der später auch markgräflicher Amtmann von Uffenheim wird. Die verschiedenen Überfälle haben
die Konsequenz, dass Lösegelderlöse der Fehdeführer mit den Schadensersatzforderung aufgerechnet werden und
Hans von Geislingen unter Bürgschaft von 10 Adeligen, darunter dem Geschlecht Rosenberg eine Schuldverschreibung
zu zahlen hat.
Die Zahlungen aus der Schuldverschreibung sollen unter den beraubten oder um Lösegeld erpressten Nürnberger
Bürgern aufgeteilt werden.
Nach dem Fälligkeitstermin 1515 melden sich die Bürgen zu Wort, da sie vertragsgemäß "in die Laistung gemant" wurden.
Die Verhandlungen gehen in Einzelfällen bis vor das Kaiserliche Landgericht des "Burggraftums Nürnberg" in Ansbach.
Ob Leonhard von Rosenberg aus dem Bürgschaft an die Stadt Nürnberg gezahlt hat oder den Klageweg bestritten hat,
bleibt unbeanwortet.

Kuntz von Rosenberg
Kuntz von Rosenberg ist Leonhards Sohn. Er wird 1520 mit Waldmannshofen belehnt. Er ist 1528
Amtmann zu Röttingen und Reichelsberg.
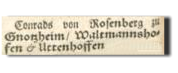
Der Oettingische Überfall
24. Juni 1520: Angehörige des Schwäbischen Bundes waren in Augsburg versammelt. Graf Joachim von Oettingen hatte
teilgenommen. Auf der Rückreise wurde er in Donauwörth gewarnt, dass verdächtige Reiter unterwegs seien. Da der Graf
aber mit Niemandem in Fehde war und auch keinen Absagebrief erhalten hatte, achtete er nicht auf diese Warnung und
setzte seine Reise fort.
Kaum hatte er Donauwörth verlassen, sah er viele Reiter. An einen Widerstand war nicht zu denken war, so gab Graf
Joachim seinem Pferd die Sporen und floh wieder zur Stadt zurück. Unglücklicherweise stürzte sein Pferd. Die Reiter um
Thomas von Absberg holten ihn ein, einer der Feinde versetzte ihm einen Stich mit dem Schwert und verwundete ihn so
stark, dass er nicht weggebracht werden konnte.
Unter den Reitern war auch Kuntz von Rosenberg mit einem Gefolge von 20 Reitern aus seinem persönlichen Anhang.
Dieser war, nachdem ihn ein als Kurier in Augsburg stationierter Rosenbergischer Knecht über eine kurze Dauer des
Bundeskonvents informiert und er Absberg verständigt hatte, aufgebrochen. Beide Gefolge trafen sich drei Tage vorher und
verschanzten sich später mit weiteren Sinnesgenossen in einem Wald.
Man ließ den Grafen mit seiner Verletzung liegen, forderte aber vorher noch das Ehrenwort von ihm, dass er sich als ihr
Gefangener bei ihnen stellen wolle, wenn er wieder genese.
Nach dem Überfall löste sich das Kommando etappenweise auf, über die Altmühl ritten die Rosenberger in Richtung des
Schlosses Waldmannshofen zurück.
In dem späteren Fehde-Brief sind Kuntz von Rosenberg oder sein Anhang nicht genannt sondern als Helfer und
Fehdediener, als "gebröt knecht", benannt. Nicht vergleichbar sind diese mit mittelalterlichen Eideshelfern, die sich für
einen verwandten oder befreundeten Prozessbeteiligten persönlich verwenden können, wenn sie von dessen Unschuld
oder der Rechtmäßigkeit seiner Forderung überzeugt sind. Als Kriegssöldner werden die Fehdediener finanziell entlohnt,
führen dafür Befehle aus, können dafür kaum belangt werden oder müssen die Wahl des Dienstherrn oder den Inhalt der
Befehle nicht verantworten.
Der schwer verwundete Graf wurde nach Donauwörth gebracht und den noch versammelten Bundesständen wurde
Bericht erstattet.
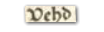
Der Anlass
Anlass für diesen Überfall war ein alte Auseinandersetzung der Absberger und Oettinger um eine Gebietsherrschaft. Der
Schiedsspruch, fast ein Jahrhundert vorher, wurde unter Auflagen erteilt, die die Oettinger nicht erfüllt haben und deren
Bestand sie nun bestritten haben.

Der Schwäbische Bund wird angerufen
Die ganze Versammlung des Bundes war empört über diesen frechen Landfriedensbruch. Nach der oettingischen
Darstellung waren die Ansprüche eine "ganntz mutwillige nichtige fordrung" und die Tat ein heimtückischer Überfall und
ohne die vorherige Absage ein fehdewidriger krimineller Raubüberfall ("lanndtfridprüchige handlung") und damit ein
Verstoß gegen die Regeln, die 1495 mit dem kaiserlichen Landfrieden verordnet wurden.
Die Versammlung beschloss die Gewalthilfe wegen des Bruches der Landfriedenssatzung und dem Truchsessen Georg
von Waldburg, dem Schwiegersohn des Verletzten, wurde die Verfolgung und Bestrafung der Täter zu übertragen. Er
erhielt außer einer Anzahl von Pferden mehrere Bundesmandate und Befehle an alle Bundesmitglieder: Wenn er deren
Gebiet betreten würde, solle er alle erforderliche Hilfe an Mannschaft und Kriegsbedarf erhalten.
Georg Truchsess von Waldburg begab sich unverzüglich zu seinem Schwiegervater nach Donauwörth. Von ihm erfuhr er
den Tathergang. Er stellte fest, dass eine Heilung des Grafen außer den Grenzen der Kunst lag.
Georg Truchsess von Waldburg schrieb den beiden Söhnen des Grafen, Martin und Ludwig, die damals in Ingolstadt
studierten, dass sie nach Donauwörth kommen sollten. Er reiste dann nach Augsburg ab. Dort unterrichtete er die
Bundesstände von dem Tathergang und dem nahen Ende des Grafen von Oettingen, empfahl ihrem Schutz die beiden
Söhne des Grafen, und forderte sie zur Bestrafung der Täter auf. Er erhielt eine Bundeshilfe von 50 Reisigen bewilligt.

Georg Truchseß von Waldburg in Franken
Mit seinen Schwägern und deren 30 Reisigen durchstreifte er zuerst das Ries, und, da er dort keine Spur mehr von den
Tätern antraf, wendete er sich nach Franken.
Dort angekommen, schickte er durch seinen Diener dem Thomas von Absberg und seinen Mithelfern einen Absagebrief.
Sie streiften daraufhin in Franken hin und her und näherten sich auch dem Schloss Absberg mit einer Abteilung von 40
Pferden, während andere 50 zum Odenwald hinzogen.
Dem Truchsess war daran gelegen, sich des Absberger Schlosses zu bemächtigen und hier das erste Beispiel von Strafe
zu geben. Es war Herbst und die Weiber des Dorfes waren gerade damit beschäftiget, die Rüben der Herrschaft
auszuziehen und in das Schloss zu tragen. Daher waren die Tore offen und eine Vorhut von Reitern des Truchsessen
drang ohne Widerstand in den Hof, nahm dem Torhüter die Schlüssel, besetzte hierauf die Tore und gab das verabredete
Zeichen, nach dem der Truchsess mit dem Rest der Mannschaft ebenfalls herbei eilte.
Das Schloss war nun für die Grafen von Oettingen in Besitz genommen, und eine Besatzung wurde zurückgelassen.
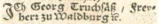
Ein kaiserlicher Achtbrief für Kuntz von Rosenberg
Am 6. August 1520 lässt Kaiser Karl V. den Achtbrief über Hans Thomas von Absberg und dessen Helfer ausstellen.
Damit ist auch verbunden, dass Lehen an den Lehnsherrn zurückfallen, bei Waldmannshofen an den Markgrafen
Casimir von Brandenburg-Ansbach.
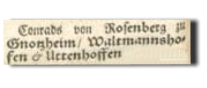
Die truchsessischen Streifereien gehen weiter
Im folgenden Jahr 1521 stellte der zu Ulm versammelte Bundestag des Schwäbischen Bundes weitere 50 Pferde zur
Verfügung des Truchsessen, der nun mit 100 Reitern im Frühjahr seine Streifereien fortsetzte.
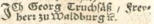
Der erste Überfall auf Waldmannshofen
Am 8. März 1521 gewann er das feste Schloss Waldmannshofen, das Kuntz von Rosenberg gehörte, durch eine
Kriegslist. Die damals im Feld arbeitenden Landleute hatten ihre Häuser nicht mehr erreicht, als sie den Zug des
Truchsessen herankommen sahen. Sie waren alle hin zum Schloss gelaufen. Nur ein altes Weib lief heulend und
schreiend im Dorf herum und wurde zum Truchsessen von Waldburg gebracht. Dieser erklärte dem Weib, dass, wenn die
Bauern das Schloss nicht verlassen und ihm einhändigen würden, er den Ort verbrennen, und alles niederhauen lassen
werde. Das Weib, das die Drohung für Ernst nahm, rannte eilig in das Schloss und sagte den Bauern, was ihr der
Truchsess gesagt hatte. Dies wirkte. Die Bauern hatten keine Lust ihre Weiber und Kinder, Häuser und Fahrnisse des
Schlosses wegen aufzuopfern. Die Bauern waren in der Überzahl, entwaffneten die schwache Besatzung des Schlosses
und überlieferten das Schloss dem Truchsessen von Waldburg.
Eine andere Quelle schildert uns: Jörg (Georg) Truchsess von Waldburg bedient sich eines taktischen Tricks. Bauern, die
ins Schloss geflüchtet sind und die Tore verrammelt haben, wird mit Gemetzeln an ihren Familien gedroht, wenn sie nicht
übergeben würden. Das Schloss wird eingenommen und, da er das verbriefte Recht hat, nach Belieben Unterstützung
anzufordern, treffen aus der Reichsstand Windsheim 12 Mann als provisorische Garnison ein. Damit verliert Kunz von
Rosenberg nicht nur sein Schloss sondern auch die Einkünfte aus diesen Ländereien, da diese nun dem Schwäbischen
Bund zustehen.
Jörg (Georg) Truchsess von Waldburg selbst gibt sich als Feind des Rosenbergers aus: "er herr Georg wer bericht, das
dis Schlos waltmanßhof(en) Conz(e)n von Rossenberg des feindt er wer zustund", auch bietet er dem Markgrafen
Casimir an, anstelle von Kuntz von Rosenberg das Lehen zu nehmen: "solt Ine als gern zu ainem lehenmann haben alls
einen von Rosenberg".
Eine Delegation aus Familienmitgliedern des Hauses von Rosenberg sowie verschwägerten und befreundeten
Geschlechtern wird drei Tage später in Uffenheim vorstellig, wo sich die Bundestruppe aufhält. Sie ersuchen um
Rückerstattung des Familienbesitzes Waldmannshofen. Sie finden jedoch keine Unterstützung bei den markgräflichen
Amtsträgern, dem Creglinger Amtmann Albrecht von Vestenberg und dem Uffenheimer Amtmann Eberhard Geyer. Beide
Amtleute vermitteln zwischen dem Truchsessen von Waldburg und den Rosenbergern und erreichen die Rücküberstellung
an Ansbach unter einer Auflage: Es soll vorerst keine erneute lehensweise Ausgabe des Schlosses erfolgen.
Waldmannshofen wird von den beiden Amtsträgern in eigener Regie verwaltet.
Von dem mobilen Besitz, wie es bei der Einnahme vorgefunden wurde, erstellen sie unter Anwesenheit eines Notars ein
genaues Bestandsverzeichnis, denn "alle varennde hab" steht nach dem Bundesreglement den Mitgliedern der
siegreichen Streife zu.
Als Besatzung bleibt ein ansbachischer Diener namens Hans Herzog im Schloss. Er hat Anweisung, dort niemanden
weder aus- noch einzulassen.
Was dann in Waldmannshofen geschah bleibt nicht ganz im Nebel der Geschichte verborgen, dazu später. Kuntz von
Rosenberg scheint sich selbst aus weiteren Absberger Fehden herausgehalten haben, er belieferte Absberger Übergriffe
lediglich mit Knechten aus seinem unmittelbaren Burggefolge. So ist der Knecht Jörg im Juli 1522 in der Oberpfalz bei
einem Überfall auf einen Nürnberger Kaufmann beteiligt.
In diese Zeit fallen Überfälle aus Mangold von Ebersteins Fehde gegen die Reichsstadt Nürnberg, an denen Kuntz von
Rosenberg teilgenommen hat.

Vermittlungsversuch der Markgrafen
Auf Ansuchen des Crailsheimer Amtmanns, des Vaters von Hans Thomas von Absberg, versuchte nun der Markgraf
Casimir von Brandenburg die Sache zu vermitteln. Der Kaiser selbst wurde beim Schwäbischen Bund vorstellig. In der
Woche nach Weihnachten 1521 wurde ein Gütetermin in Ansbach gehalten. Die Teilnehmer vom Schwäbischen Bund,
die Grafen von Öttingen und die von Absberg kamen jedoch nicht zu einer Einigung, da versuchte wurde, verschiedene
Streitigkeiten (die alte Auseinandersetzung, den Tod des Grafen von Öttingen und eine Gefangennahme kaiserlicher
Diener) zu vermitteln. In einem Vermittlungsvorschlag heißt es: "Doch was Schadens Kunzen von Rosenberg und seinen
Muhmen geschehen, sollte Kunz von Rosenberg selbst tragen."
Eine andere Quelle schildert einen Vertrag vom 5. Januar 1522: Kuntz von Rosenberg soll seine Immobilien
zurückerhalten, er erhält, entgegen einer Entschädigung für Absberg, allerdings keine Entschädigung, da er weiter als
Fehdehelfer für seinen Verwandten, Mangold von Eberstein, tätig ist.
Die Fehde könnte damit beendet und Reichsacht aufgehoben werden. Dieser Vertrag steht unter Bedenkzeit und unter
Zustimmung der Grafen von Oettingen und des Schwäbischen Bundes, die dann im Februar/März 1522 erfolgen soll. Er
wird automatisch gegenstandlos, wenn nicht beigepflichtet und ein Lösegeld bezahlt wird oder Absberg dem Vertrag
nicht bis 22. März 1522 zugestimmt hat. Noch Anfang März ersuchte der kaiserliche Verhandlungsträger, die Deligierten
des Schwäbischen Bundes und die Öttinger die Ablehnung zu überdenken. Diese lange Frist für die Beilegung des
Streites steht in direktem Verhältnis zu der anstehenden Verlängerung des Zusammenschlusses zum Schwäbischen
Bund. Diese wird am 17. März 1522 für weitere 12 Jahre geschlossen und kurze Zeit später von Kaiser Karl V. bestätigt.
Es stellt sich heraus, dass der Stillstand in der Beilegung des Streites dienlich für die entscheidende Endphase der
Verhandlungen zur Verlängerung war.
Kuntz von Rosenberg hat gute Gründe, sich für vier Geiseln einzusetzen, die Absberg seit 1521 in Verwahrung hat: ihm
wurde -inoffiziell- zu verstehen gegeben, dass er sich sein Schloss Uttenhofen erst zurückverdienen müsse. Falls er
Absberg mindestens einen Gefangen "ledig mache" darf er heimkehren; Kuntz schildert diesen Kuhhandel in einem Brief
vom 14. März 1523 und berichtet, dass er die Weisung bereits auf dem Gütetermin 1521 in Ansbach erhalten habe. Hier
ist auch zu erfahren, dass die Geiseln ohne sein Zutun frei gekommen sind; er bittet darum, ihm sein Schloss
zurückzugeben, da durch sein Engagement -erfolglos oder nicht- sein Teil der Abmachungen erfüllt ist.
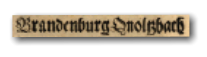
Ein Überfall bei Wallmersbach
Am 18. April 1522 überfällt Hans Thomas von Absberg einen von der Frankfurter Messe heimkehrenden Augsburger
Kaufmann bei Wallmersbach und nimmt ihn gefangen. Unterschlupf finden die vier Täter und die Geiseln unter anderem
zu Giebelstadt beim Uffenheimer Amtmann Eberhard Geyer. Damit nimmt Absberg nach Nürnberg auch mit Augsburg
die Händel auf. Beide Reichsstädte sind dem Schwäbischen Bund angeschlossen. Der Schwäbische Bund bietet im
Moment aber keine weiteren Truppen auf, als den bestehenden oettingischen Streifkorps mit 104 Mann.
Der zweite Überfall auf Waldmannshofen
Am 19. Mai 1522 informiert Hans Herzog, der vom Markgrafen eingesetzte Verwalter Waldmannshofens, das Ansbacher
Regiment und den Markgrafen, dass mehrere oettingische Streifreiter vor der Burg erschienen seien und um Unterkunft
und Proviant ersucht hätten. Obwohl Herzog sie auf seinen ausdrücklichen Befehl verwiesen habe, er dürfe niemanden ins
Schloss lassen und nicht von den dortigen Beständen ausgeben, sei ihnen kurz darauf das Gros der Reiter mit dem
Hauptmann Georg von Waldburg nachgefolgt und habe ihre Forderung unterstützt.
Der Vogt behielt zwar die Nerven, wurde aber unruhig, da er befürchten muss, mit einer Fehlentscheidung den Widerwillen
des Bundes auf das Haupt seines Herren zu laden. Er bittet daher nochmals um genaue Anweisung. Zwei Tage später
erhält er nicht nur die volle Zustimmung in sein Verhalten, sondern darüber hinaus die Aufforderung, in keinem Punkt
davon abzuweichen: "unser begern .. das du dich seine f.g. beuelhs haltest, und dawider .. kain anders thust,". Herzog soll
dem Waldburger zudem ausrichten, die Bundesstreifen verfügen über genügend Zehrgeld, um sich aus eigener Tasche zu
versorgen.
Vielleicht fürchtet der Markgraf auch unnötiges Missfallen in seinem fränkischen Adel zu erregen, wenn er zulässt, das
ausgerechnet in Waldmannshofen eine Operationsbasis der Plackerbekämpfer etabliert wird.
Waldburg revanchiert sich für die respektslose Abfuhr, in dem er später markgräfliche Kontingentsreiter im Streifkorps
bezichtigt, sie hätten sich unerlaubt von der Truppe entfernt.

"der zug wid(er) die francken sey entlich beslossen.."
Trotz Verhandlungen der fränkischen Reichsritterschaft mit dem Reichsregiment, den Reichsstädten und dem
Schwäbischen Bund wird dieser Feldzug des Schwäbischen Bundes im März 1523 beschlossen. Als Sammlungstag für
das gesamte Heer und die Artellerie ist der 1. Juni festgesetzt.
Bundesvorladungen ergehen nun an den fränkisch-nordwürttembergischen Adel und die markgräfliche Ritterschaft.
Diese werden im Umgang mit Landfriedensbrechern verdächtigt. Sie können sich mündlich rechtfertigen und es kann
eine eidliche Reinigung von ihnen verlangt werden.
Sollte sich der Adressat seiner Vorladung widersetzen, drohen ihm Schritte in nicht näher festgelegtem Umfang.
Viele betroffene Adlige wandten sich an den Markgrafen Casimir und dementieren jegliche Hilfeleistung.
Dem Markgrafen selbst sind allerdings die Hände gebunden, mit einem Eingreifen läuft er selbst Gefahr, gegen
Reichsgesetz zu verstoßen und sich von den anderen Bundesfürsten zu isolieren.
Es bleibt ihm lediglich, eine diplomatische Note an die Bundesversammlung zu leiten, in der er die Kompetenz des
Bundes kritisiert, Verdächtige zu befragen, als Exekutoren aufzutreten und in den verschickten Ladebriefen mit Krieg zu
drohen. Streng kritisiert er auch die Sonderfreiheiten des Schwäbischen Bundes, dass reichsrechtliche Bestimmungen
hinter denen des Bundes zurücktreten.
Einige Reichsritter verweigern ihre Anwesenheit oder verlassen den festgesetzten Vorladungstermin vorzeitig. Dies
macht ihre Sitze zu Angriffszielen des Schwäbischen Bundes.
Kuntz von Rosenberg ist mit Hans Thomas von Absberg als Haupttäter geächtet. An ihn ergeht keine Vorladung.
Der schwäbische Chronist Martin Crusius fasst das Geschehen ab dem 1. Juni lapidar zusammen:
"innerhalb 2. Monathen 23. Fränkische Schlösser und Vestungen, in welchen gemeldter Johann Thomas eine Retirade
und Aufenthalt hatte, demolirt, weilen die Adeliche Besitzer derselben.. ihre Unschuld mit keinem Eyd purgiren konnten."
Die gesamte Streitmacht des Heeres setzt sich aus 1000 Reitern und etwa 10.000 Fußsöldnern sowie Feld- und
Belagerungsartellerie in unterschiedlicher Größe zusammen.
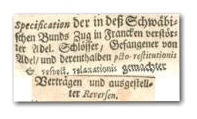
Der dritte Überfall auf Waldmannshofen
Am 22. Juni wird nun das Waldmannshöfer Schloss angegriffen und verbrannt: "Item montags den
zwenundzwaintzigisten juny sind herr Jorg Truchsas, veldthaubtman, und das kriegsvolckh fort uff Uffenhaim geruckt,
doselbt den Eritag stillgelegen, in derselben zeit zwen veindtsbrieff durch einen knaben gen Waltmanshouen und Gnetze,
bede Cuntzen von Rosenberg zugehörig, geschickt und dieselben zway heuser sambt iren zugehörenden pauern und
nutzungen erfordern lassen. Aber in denselben heusern ist niemandt gefunden worden.
Uff solche handlung ist erstlich das schloss Waltmaushouen, welchs dann gar geraumbt und ausgeleret gewest, durch
den obersten veIthaubtman und andere haubtleute verprennt, die paurn auch in des bundes pflichten angenomen, mit der
aufflage, dhweil sich dieselben paurn hienor wider ir zusagen gegen herr Jorgen Truchsasen etwas ungepürIichs,
ungehorsam und strafbar gehalten haben, also das sy die paurn plünderns oder zum wenigsten pranntschatzung wirdig
gewest weren, das demnach die paurn zu einer straf gemainlich und ein yeder sunderlich, sunder ainicher were mit
weissen steblein den negsten zu den bundsraten, so damals zu Hasfurt gewest, sich stellen, antzaigen, doselbst weiters
beschaids und der gnade erwartten sollen. "
Eine andere Quelle schildert uns: Zwischen dem 22. und 23. lässt sich die Hauptarmee in der Nähe von Uffenheim nieder.
Auf dem Weg liegt das Städtchen Aub, zu einer Hälfte Kuntz von Rosenberg zum andern dem Würzburger Oberhirten
zuständig. Dort wird alles rosenbergische Eigentum übernommen, der Ort selbst mit einer Brandsteuer belegt: "umb
tausend gulden gepranntschatzt". Das Wittum von Kuntzens Ehefrau wird gleichfalls beschlagnahmt: "nit mer dann ir
varnus, clainotter und claider gelaßen".
Von Uffenheim entsendet Jörg Truchsess von Waldburg einen Trupp, der das nahe bei Aub gelegene Waldmannshofen
übernehmen und schleifen lassen soll. Das Schloss steht schon seit seiner Einnahme 1521 unter markgräflicher
Direktverwaltung und ist nicht nur verlassen, sondern auch leergeräumt (durch Hans Herzog im Auftrag Markgraf
Casismirs?).
Ein Teil der zur Schlossherrschaft gehörigen Bauern scheint den Bündischen mit einigem Widerwillen zu begegnen,
woraufhin Waldburg sie eidlich in die Pflicht nimmt, sich den zu Haßfurt sitzenden Bundeskommissaren zu stellen.
Inwieweit hierbei alte Animositäten zwischen dem markgräflichen Vogt Hans Herzog und dem Truchsess von Waldburg
zum Tragen kommen, bleibt unklar, ebenso, ob Herzog zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch in Waldmannshofen Dienst
tut.
Denkbar wäre auch, dass die Bauern Kuntz von Rosenberg eine gewisse Anhänglichkeit bewahrt haben oder aber dem
Markgrafen, den sie geschädigt glauben.
Einen Abstecher nach Gnötzheim führt derweil Kriegsrat Burghard Marschall mit einigen städtischen Reitern aus. Auch
Kuntz von Rosenbergs zweites Schloss - und damit das Dritte des Gesamthauses Rosenberg nach Boxberg - wird
eingerissen.
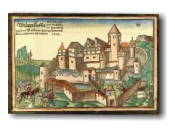
Die Urfehde
Kuntz von Rosenberg leistet schließlich am 19. Oktober 1523 "auß sorgen" Urfehde:
" Ich Conradt von Rosenbergk zu Gnetzheim Bekhenn offentlich mit dem brief. Nach mir darumb das ich gemeins Bundts
zu Schwaben offentlich Beclert und verkundt Aechter Landtfriedbrecher unnd desselben Bundts beschediger, wieder den
Landfrieden gehaust gehoft, geatzt, getrenckt, enthalten selbs mit gritten bin, hilff gethan unnd fürgeschoben hab, zu
pillicher straff Itzt angezeigter verwurkung von gemeinen Stenden des Bundts zu Schwaben Meine Schlösser unnd sitz.
Waltmanshofen, Gnotz unnd Uttenhofen außgebrendt und zerriessen, und dazu meine gutter eingenommen, die mir
nochmals Ine Standt und werdt, wie die Itzt gefunden, auf mein unnd anderer meiner Herren und freundt unterthenig
hochfleissig bitt, und bezahlung Tausent Gulden Reinisch an erstattung gemeines bundts aufgelauffens schadens,
wiederumb eingeben unnd zugestelt sein. Und darzu ich gnediglich auß sorgen gelassen, unnd wiederumb zu gemeins
bundts Huldigung genomen bin.
Daß ich das alles unnd iedes zu velligem gnügen, unnd underthenigem fleissigem Dank angenomen, unnd mich umb
solcher erzeigter gnaden willen daruf verpflicht verbunden unnd verschrieben hab, und thun das hiemit wissentlich in
crafft ditz briefs.
Nemlich das ich noch mein erben samentlich od sonderlich das obberurt überziehen, außbrennen unnd zerreissen
gemelter meiner Schlosser unnd sitz, unnd einnemen meiner güter unnd derselben Nutzung, und was in unnd mit
solchem allem unnd yeden, auch gegen meiner Person von wegen gemeins Bundts fürgenomen, geubt unnd begangen
ist, gegen gemeinen Stenden des Bundts samentlich od sonderlich od denen so Inen zu versprechen steen, unnd so
darunder gehandelt haben, Iren nachkomen unnd erben, In argem od unguttem, hinfuro ewiglich durch uns selbs noch
Jemandt andern von unsert wegen, nit andern ässern noch wehren, weder mit noch one recht keine clag haben,
furnemen noch gewinnen sollen noch wollen, Darzu soll unnd will ich mein leben lang umb keinerlei sachen willen, gegen
den Bundtsstenden, gemeinlich od sonderlich, mit der that furnemen, handeln noch zu thun gestatten verschaffen od
verwilligen, auch wieder sie zu thetlicher Handelung, niemandt hausen hofen noch furschieben, gantz in kein weiß,
Sonder gemeiner Bundtsstende schaden warnen, unnd fromen werben unnd furdern, Unnd ob ich ausser halb obherurter
billicher empfangener straff, derhalben ich mich dan wie oblaut für unnd mein erben, aller forderung entlich verziehen
hab, über kurtz od lang, zu gemeinen Stenden des Bundts gemeinlich oder sonderlich, oder denen so Inen zu
versprechen steen, Ir nachkomen unnd erben Spruch od Vorderung hete od gewinne, Worumb das were, das soll unnd
will ich nit anderst suchen noch furnemen dan mit ordenlichem rechten, an den enden, unnd in den gerichten, darin ein
Jeder nach des heiligen Reichsordnung geherig ist, unnd sie darüber mit auslendischen Gerichten unnd sachen, nit
dringen noch beschweren one geverde, das alles unnd Jedes whar, steet, unnd vhest zu halten, hab ich obgenanns
Conradt von Rosenberg, mit treuen an Aydts stat zugesagt, unnd zu warem urkundt
der Ding mein eigen Insiegel offentlich an diesen brief gehangen, darzu solchen blief mit meiner eigen Handt
underschrieben, unnd mit fleis erbetten, die Edeln unnd Vhesten Lorentz von Rosenberg Amptman zu Mekmüll unnd
Bernhardten von Thungen, Amptmann zu Rottenfels mein liebe Vettern, das sie Ire eigene Insiegel, darunder ich mich
auch verbindt zu halten was vorsteet auch an diesen Brieff, doch Inen unnd Iren erben one schaden, gehangen haben.
Der geben ist auf Montag nach Sanct Gallentag nach Christi gepurt 1523."
Damit erfüllt er die Bedingungen: er gesteht nicht nur die Beherbergung sondern auch die Mittäterschaft und verzichtet
auf Rechtsmittel. Er hat 1.000 Gulden beizubringen, eine Pauschale für die Aufwendungen des Schwäbischen Bundes.
Dafür wird er wieder ins seine Herrschaften zu Waldmannshofen, Uttenhofen und Gnötzheim eingesetzt. Zwei Bürgen,
Lorenz von Rosenberg und Würzburgs Bundesrat Bernhard von Thüngen bezeugen seine Aussöhnung. Lorenz von
Rosenberg, Kuntz Vetter, haftet in Gemeinschaft mit anderen Rittern für die fristgemäße Auszahlung der
Kostenvergütung. Diese war im Sommer 1527 noch nicht bezahlt und ihm wurde ein weiteres Jahr Aufschub gewährt.
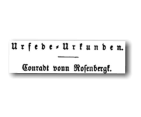
Verwandschaftliche Bande
Sicherlich müssen wir Kuntz von Rosenbergs Fehdetätigkeit auch im Zusammenhang mit dem
Gesamthaus Rosenberg betrachten, das immer wieder mit der Kaufmannsstadt Nürnberg in Fehde war.
Mit der Zerstörung eines Vorpfostens zur Pfalz und der verkehrstechnisch zentral an dem
Kreuzungspunkt Frankfurt Augsburg und Würzburg Esslingen gelegenen Burg Boxberg in 1523 war ein
Höhepunkt erreicht, der später mit einer Auseinandersetzung um die lange währende Gefangennahme
eine Nürnberger Kaufmanns oder der Gefangennahme des Sohnes von Georg von Waldburg übertroffen
wurde.
Die Fehdetätigkeit übte er auch für seinen Schwager Mangold von Eberstein aus. Interessant sind die
Berichte über die einzelnen Überfälle ganz ins unserer Nähe oder Kuntz von Rosenberg Erscheinung, die
wir dort nachlesen können.

Quellen, davon viele im Netz zu finden:
Ritzmann, Plackerey in teutschen Landen, 1995 (Hauptquelle)
Vochezer, Geschichte von Waldburg Band 2, 1832 (erster und dritter Überfall)
Walcher, Biografie des Truchsessen Georg III von Waldburg, 1900 (erster und dritter Überfall)
von Eberstein, Geschichte der Freiherren von Eberstein, 1865 (weitere Fehdetätigkeit des Kuntz von Rosenberg)
von Eberstein, Fehde des Mangold von Eberstein mit Nürnberg, 1879 (weitere Fehdetätigkeit des Kuntz von Rosenberg)
Anzeiger für die Kunde der Deutschen Vorzeit, 13. Band, 1866 (dritter Überfall)
May, Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II von Mainz und Magdeburg, 1865 (Urfehde des Kuntz von Rosenberg)
Historisches Unterfranken, Uni Würzburg (Landfrieden von 1404)
Nicht verwendete sonstige Quellen:
Baader, Verhandlungen über Thomas von Absberg und seine Fehden, 1873 (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, Band 114)
Archiv für die zeichnenden Künste, 1841-1842: Übersicht von Holzschnitten der 1523 angegriffenen Schlösser
Lister der Wandereisen Holzschnitte, wikipedia
Herolt,
Hällische
Chronik,
1494
-
1545
Manuskript
oder
Kolb,
Geschichtsquellen
der
Stadt
Hall
in
Württembergische
Geschichtsquellen,
1894
Urkunden zur Geschichte des Schwäbischen Bundes Teil 1 und Teil 2 (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, Band 14)
Romane:
Schönhuth, Sagen und Geschichten aus Hohenlohe, 1857 (Ein Besuch des Absbergers in Waldmannshofen)
Hammerstein, Ritter, Tod und Teufel. Ein Bilderbuch aus dem 16. Jahrhundert, 1910 (Fehde des Mangold von Eberstein)













